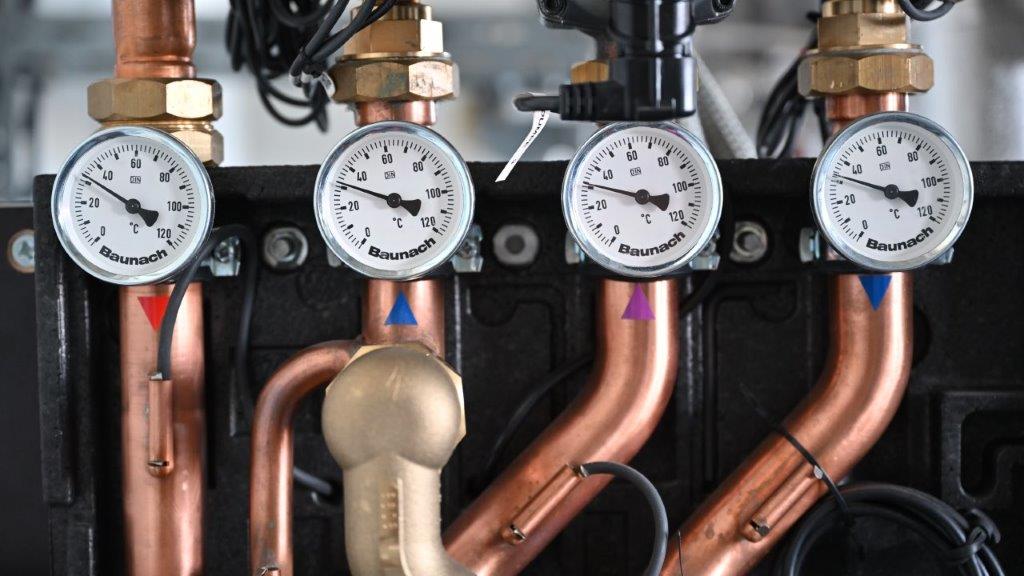Tübinger Verpackungssteuer
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat seine Urteilsbegründung zur Tübinger Verpackungssteuer vorgelegt. Der Tenor: Die Steuer verstößt gegen das Abfallrecht des Bundes. Zudem dürfe Tübingen eine solche Steuer gar nicht einführen.
„Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes“
Die Tübinger Verpackungssteuer verstößt aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim gegen das Abfallrecht des Bundes. Grund sei das Verpackungsgesetz, das die Vermeidung und Verwertung der gesamten Palette an Verpackungsabfällen und damit auch der Einwegverpackungen, die Gegenstand der Tübinger Verpackungssteuer sind, detailliert regele. Folglich handele es sich beim Verpackungsgesetz um ein geschlossenes System, das Zusatzregelungen durch den kommunalen Gesetzgeber ausschließe.
Nach Auffassung der Richter haben Kommunen auch nicht die Zuständigkeit, die abfallwirtschaftliche Zielsetzung der Abfallvermeidung eigenständig voranzutreiben. Auch wenn das Ziel einer Reduzierung des Verpackungsaufkommens auf Grundlage der bisherigen Regelungen im Verpackungsgesetz nicht erreicht worden sein sollte, sei es Sache des Bundesgesetzgebers, das Regelungssystem des Verpackungsgesetzes fortzuentwickeln. Etwaige Versäumnisse des Bundesgesetzgebers berechtigten die Kommunen nicht dazu, dessen Entscheidungen in eigener Zuständigkeit zu „verbessern“.
Wie die Richter weiter erklären, habe Tübingen zudem nicht die Befugnis, eine Verpackungssteuer einzuführen, da es sich nicht um eine örtliche Steuer handele. Die Steuer sei nämlich nicht auf Verpackungen für Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle begrenzt, sondern erfasse auch den Verkauf der Produkte zum Mitnehmen. Damit sei der örtliche Bezug der Steuer nicht ausreichend sichergestellt und es sei nicht gewährleistet, dass der Verbrauch der Verpackung vor Ort im Gemeindegebiet stattfinde.
„Nicht ausreichend vollzugsfähig“
Die umstrittene Verpackungssteuer, die zu Jahresbeginn in Tübingen eingeführt wurde, bezieht sich auf Einweggeschirr und Coffee-to-go-Becher: Für jeden Einweggetränkebehälter sowie für Einweggeschirr und -speiseverpackungen sind 50 Cent fällig. Für jedes Einwegbesteck-Set 20 Cent. Pro Einzelmahlzeit werden maximal 1,50 Euro kassiert. Die Steuern müssen die Verkaufsstellen zahlen, die in den Einwegverpackungen Speisen und Getränke für den sofortigen Verzehr oder zum Mitnehmen ausgeben. Etwa 440 Betriebe beteiligen sich.
Wie aus der Urteilsbegründung weiter hervorgeht, stören sich die Richter am Verwaltungsgerichtshof auch am Begriff Einzelmahlzeit. Dieser Begriff sei „nicht ausreichend vollzugsfähig“ und verstoße damit gegen den Grundsatz der Belastungsgleichheit im Grundgesetz. So seien die steuerpflichtigen Betriebe auf die freiwilligen Angaben des Konsumenten angewiesen. Bei größeren Sammelbestellungen bestehe die Gefahr, dass Konsumenten wahrheitswidrige Angaben machen, um die Steuer zu umgehen. Folglich entstünde ein Vollzugsdefizit. Wegen der enormen Höhe der Besteuerung und des damit verbundenen starken Preisanstiegs für Speisen und Getränke liege die Gefahr wahrheitswidriger Erklärungen der Konsumenten auf der Hand, so das Gericht.
Gericht erklärt Tübinger Verpackungssteuer für unwirksam