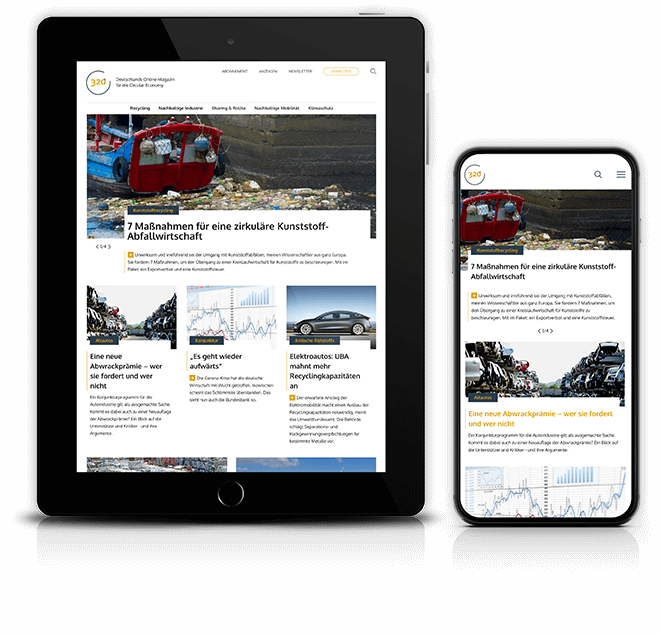Kunststoffrecycling
kostenpflichtigHydroPRS heißt das Verfahren, das Mura Technology für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen verwendet. Der weltweite Roll-out der Technologie wird derzeit vorbereitet. Ökologische Zweifel will die Firma mit zwei Ökobilanzen ausräumen.
Chemisches Recycling: Mit überkritischem Wasser zu weniger CO2-Emissionen
Jenseits von 374 Grad Celsius und unter hohem Druck nimmt Wasser eine kuriose Form an: Es ist flüssig und gasförmig zugleich. Ein solches sogenanntes überkritisches Wasser besitzt die Dichte von normalem Wasser und die Fließfähigkeit von Wasserdampf – Eigenschaften, die mittlerweile bei diversen technischen Anwendungen gezielt ausgenutzt werden.
So gibt es inzwischen Kohlekraftwerke, die im Dampfprozess mit überkritischem Wasser arbeiten, weil sich dadurch der Wirkungsgrad steigern lässt. Zudem wird überkritisches Wasser als Lösungsmittel genutzt. Damit lassen s